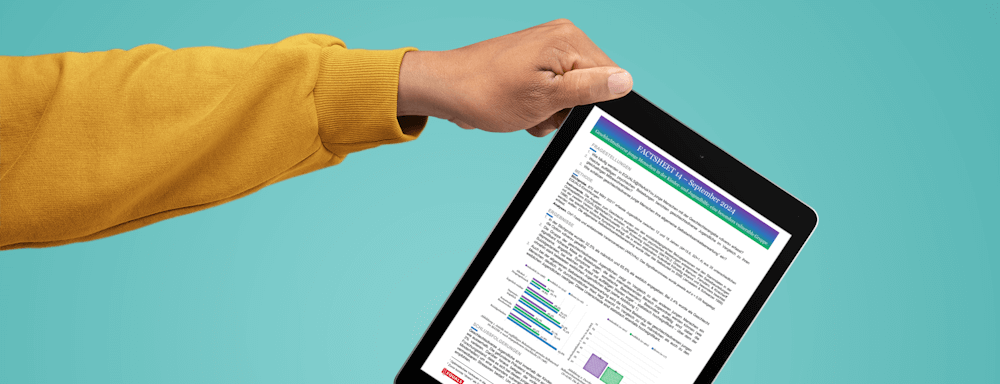Wir haben die Daten von geschlechtsdiversen Jugendlichen analysiert und mit denjenigen ihrer gleichaltrigen Mitbewohnenden verglichen. Die Ergebnisse sind bedenklich.
Einleitung
Trotz des wachsenden globalen Engagements und rechtlicher Fortschritte zeigen auch aktuelle Studien weiterhin, dass sexuelle und geschlechtliche Minderheiten, insbesondere auch geschlechtsdiverse Jugendliche, einem höheren Risiko für psychische Gesundheitsprobleme ausgesetzt sind (Semlyen et al., 2016). Sie unterstreichen, dass diese jungen Menschen besonders anfällig für depressive Symptome, Angststörungen, Substanzmissbrauch, Essstörungen und Verhaltensprobleme sind (Austin et al., 2013; Day et al., 2017; Russel & Fish, 2016; Scannapieco et al., 2018; Watson et al., 2020; Thorne et al., 2022). Diese erhöhte Vulnerabilität wird oft durch Diskriminierung, soziale Isolation und fehlende Unterstützung in ihrem sozialen Umfeld verschärft.
Wie ist die Situation von geschlechtsdiversen Jugendlichen in der Kinder- und Jugendhilfe einzuschätzen?
Konkret wurden in diesem Beitrag folgenden Fragestellungen nachgegangen:
- Wie häufig werden in EQUALS@WeAskYou junge Menschen mit der Geschlechterangabe «divers» erfasst?
- Welche auffälligen psychischen Belastungen berichten geschlechtsdiverse Jugendliche im Vergleich zu ihren gleichaltrigen Mitbewohnenden?
- Wie schätzen geschlechtsdiverse junge Menschen ihre allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung ein?
(Unter der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung wird das Vertrauen in die eigene Fähigkeit verstanden, Herausforderungen zu bewältigen und gewünschte Ergebnisse zu erzielen.)
Methode
Zur Beantwortung der Fragestellungen konnten die Daten von 870 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren (M=15.6, SD=1.4) aus 35 unterschiedlichen EQUALS-Einrichtungen analysiert werden.
Die Angaben zum Geschlecht wurden von den sozialpädagogischen Bezugspersonen mit den Stammdaten in der Onlineplattform EQUALS@WeAskYou erhoben. Da die Option «divers» erst seit März 2021 zur Verfügung steht, wurden entsprechend nur Daten berücksichtigt, die seit diesem Zeitpunkt und bis und mit Juli 2024 erfasst wurden.
Angaben zu den psychischen Belastungen entstammen den Selbstbeurteilungen mit der zweiten Version des Massachussetts Youth Screening Instruments (MAYSI-2; Grisso & Barnum, Famularo, & Kinscherff 1998), das spezifische klinische Symptome erfragt, die in einem stationären Aufenthalt frühzeitig erkannt und besonders beachtet werden sollten. Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung wurde über das Selbsturteil im SWE (Jerusalem & Schwarzer 1999) erfasst.
In den statistischen Analysen wurden Chi2-Tests und einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVAs) verwendet. Das Signifikanzniveau wurde jeweils auf α = 0.05 festgelegt.
Ergebnisse
In der Stichprobe wurden 32.5% als männlich und 65.6% als weiblich angegeben. Bei 2.4% wurde als Geschlecht die Option «divers» gewählt.
Die Gruppe der geschlechtsdiversen Jugendlichen zeigte im Vergleich zu den anderen jungen Menschen ein signifikant höheres Mass an Belastungen, die insgesamt eher dem internalisierenden Bereich zugeordnet werden können: Über 80% gaben ein besorgniserregendes Mass an depressiven und/oder ängstlichen Symptomen an, 75% berichteten über eine auffällige Anzahl an somatischen Beschwerden. Im Vergleich dazu waren es im depressiv-ängstlichen Bereich unter den männlichen Jugendlichen etwas weniger als die Hälfte und unter den weiblichen Jugendlichen rund 75%, die Werte im auffälligen Bereich hatten. Bei den somatischen Beschwerden waren es rund 35% (männliche Jugendliche) resp. zwei Drittel (weibliche Jugendliche).
Besonders auffällig waren die Suizidgedanken, bei welchen der Anteil mit auffälligen Werten unter den geschlechtsdiversen jungen Menschen sogar –statistisch hochsignifikant –über dem der ohnehin stark belasteten weiblichen Jugendlichen lag. Von den 16 geschlechtsdiversen Jugendlichen, welche den MAYSI-Fragebogen bearbeitet hatten, hatten 15 (93.8%) mindestens eine der folgenden Fragen bejaht: (1) «Hast du dir gewünscht, du wärst tot?», (2) «Hattest du das Gefühl, das Leben sei nicht mehr lebenswert?», (3) «Hattest du das Bedürfnis oder den Wunsch, dich selbst zu verletzen?», (4) «Hattest du das Bedürfnis oder den Wunsch, dich umzubringen?», (5) «Hast du die Hoffnung für dein Leben verloren?». Unter den männlichen Jugendlichen traf dies «nur» bei rund 40% und unter den weiblichen Jugendlichen «nur» bei rund 58% zu.
Abschliessend wurde die höhere Belastung der geschlechtsdiversen Jugendlichen auch durch die Betrachtung deren durchschnittlichen allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung deutlich: Ihr Schnitt (T-Wert von 34) lag sowohl im Vergleich zu den männlichen (T-Wert von 46) als auch zu den weiblichen Jugendlichen (T-Wert von 44) niedriger. (Ein T-Wert ist ein standardisierter Wert, der durch eine statistische Transformation entsteht. Er zeigt an, wie weit eine Person im Vergleich zu einer Referenzgruppe liegt. Der Mittelwert liegt bei 50, und die Standardabweichung beträgt 10.) Diese Unterschiede waren statistisch ebenfalls hochsignifikant.
Unser Factsheet, das die Auswertungen zusammenfasst und die Ergebnisse visualisiert darstellt, finden sie hier.
Schlussfolgerungen
Geschlechtsdiverse Jugendliche sind innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe mindestens genauso häufig anzutreffen, wie ausserhalb. Die gefundene Prävalenz entspricht anderen publizierten Zahlen, die je nach Kontext zwischen 1 und 3% variieren. Eine Limitation unserer Untersuchung besteht allerdings darin, dass die Angaben zum Geschlecht auf den Einschätzungen der sozialpädagogischen Bezugspersonen basieren. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Anteil geschlechtsdiverser Jugendlicher höher liegen könnte, wenn die jungen Menschen ihre Geschlechtsidentität selbst angegeben hätten.
Darüber hinaus belegen die vorliegenden Auswertungen in Übereinstimmung mit dem aktuellen Forschungsstand, dass es sich bei diesen jungen Menschen (so wie auch bei anderen geschlechtlichen oder sexuellen Minderheiten) um eine besonders vulnerable Gruppe handelt, die eines besonderen und spezifischen Schutzes vor vermeidbaren Stressoren bedarf.
Dabei können vielleicht Themen wie das Vorhalten geschlechtsneutraler sanitärer Anlagen, was in der Öffentlichkeit oft diskutiert wurde und vielerorts bereits weitgehend umgesetzt wurde, durchaus ein Punkt sein. Wie uns allen klar sein sollte, greift ein alleiniger Fokus auf solche Massnahmen jedoch definitiv zu kurz. Damit allein dürfte nur ein verschwindend kleiner Teil der Herausforderungen dieser Gruppe Entlastung finden. Es ist entscheidend, dass solche Initiativen nicht zu blossen Alibiübungen verkommen, die lediglich den Anschein erwecken, auf die Bedürfnisse der betroffenen Gruppen einzugehen, während grundlegende strukturelle Probleme unangetastet bleiben. Ein echtes Engagement für Inklusion erfordert weitreichendere, tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft und den Institutionen, die nicht bei symbolischen Massnahmen enden dürfen.
Die Ergebnisse deuten insgesamt auf eine tiefe Verzweiflung bei vielen dieser jungen Menschen hin. Ihre Belastungen müssen erkannt und ernst genommen werden. Es ist entscheidend, alles daran zu setzen, das Gefühl der Ohnmacht zu lindern, das psychische Wohlbefinden und die Lebensfreude zu fördern.
Um herauszufinden, was dies für Ihre Institution bedeutet, wird die Zusammenarbeit mit geeigneten Fachstellen empfohlen. Dabei und darüber hinaus sollte der direkte Dialog mit den Menschen, die in dieser Situation stehen, gesucht werden, um ihre Perspektiven und Bedürfnisse noch besser zu verstehen.